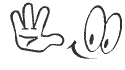Donnerstag, 22. Februar 2007
 Wer hat nicht schon einmal die Nacht durchgelesen, weil ihn ein Buch nicht losgelassen hat. Gute Schriftsteller beherrschen die Kunst, Buchstaben in lebendige Geschichten zu verwandeln und damit Leser zu fesseln.
Wer hat nicht schon einmal die Nacht durchgelesen, weil ihn ein Buch nicht losgelassen hat. Gute Schriftsteller beherrschen die Kunst, Buchstaben in lebendige Geschichten zu verwandeln und damit Leser zu fesseln.
Sprecherin:Die Kunst der Worte, die Kunst, Buchstaben in lebendige Geschichten zu verwandeln und damit Leser zu fesseln – das ist das Talent, das einen Schriftsteller ausmacht. Der Schriftsteller, derjenige, der eine Schrift, also einen Text, erstellt, war noch bis zum 16. Jahrhundert dafür zuständig, Rechts- oder Bittschriften aufzusetzen. Seit dem 17. Jahrhundert wird das Wort Schriftsteller nur noch als Berufsbezeichnung für denjenigen verwendet, der Romane, Erzählungen, Gedichte oder Sachbücher schreibt.
Sprecher:Ein bekannter deutscher Schriftsteller ist Wolfgang Bittner. Der Sechzigjährige stammt aus Gleiwitz in Oberschlesien, ist an der Nordseeküste aufgewachsen und lebt heute in Köln. Er hat über dreißig Bücher geschrieben. Viele davon sind in andere Sprachen übersetzt worden. Wolfgang Bittner ist mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet worden.
Wolfgang Bittner:"Das Schreiben macht mir Spaß. Es ist harte Arbeit, herauszufinden, wie man etwas formuliert. Das, was sich gedanklich vorbereitet, in Worte zu fassen, aufs Papier zu bringen. Und zwar so, dass man hinterher mit dem Ergebnis zufrieden ist, oder dass es sogar übertroffen wird von dem, was man im Kopf hatte. Das ist harte Arbeit."
Sprecherin:Etwas in Worte zu fassen ist ein eleganter Ausdruck dafür, etwas zu formulieren, etwas in Worten auszudrücken. Der Wortstamm geht zurück auf das altnordische "fata", "zusammenfügen". Aus dem gleichen Stamm leitet sich auch das Substantiv Verfasser ab. Ein Verfasser hat ebenfalls einen Text hergestellt. Allerdings ist Verfasser keine Berufsbezeichnung, wie Schriftsteller. Verfasser ist jeder, der einen Text, gleich welcher Art, geschrieben – man sagt auch verfasst - hat. Schreibt man zum Beispiel einen Brief, ist man der Verfasser des Briefes. Aber deswegen noch lange kein Schriftsteller.
Sprecher:Ein Schriftsteller dagegen ist immer auch ein Verfasser. Nämlich der Verfasser der eigenen Texte. Wolfgang Bittner hat seine schriftstellerische Begabung bereits als Kind entdeckt. Trotzdem hat er zunächst den Beruf des Rechtsanwalts erlernt und das Studium der Rechtswissenschaften sogar mit einem Doktortitel abgeschlossen. Seine Liebe zur Literatur war jedoch größer.
Wolfgang Bittner:"Ich hatte eigentlich immer vor, Schriftsteller zu werden. Aber mir hat zeitweise auch die Juristerei durchaus zugesagt. Bis ich eben merkte, das ist nicht das, was ich bis an mein Lebensende machen möchte. Ich habe während des Studiums dann vermehrt angefangen, für Zeitungen zu arbeiten, auch für den Rundfunk. Das trainiert natürlich auch das Schreiben, so dass sich das allmählich vorbereitet hat. Man kann ja nicht heute sagen, ab morgen bin ich Schriftsteller. Das klappt ja nicht. Sondern man muss das ausprobieren, auch, ob das finanziell geht, freiberuflich als Schriftsteller tätig zu sein. Denn es gibt ja viele. Aber in den seltensten Fällen klappt das."
Sprecherin:Der Ausdruck etwas klappt oder etwas klappt nicht anstelle von "etwas funktioniert" oder "etwas funktioniert nicht" ist im Deutschen sehr gebräuchlich. Er leitet sich ab von dem Verb klappen, der Bezeichnung für "mit einem leichten Geräusch aufeinandertreffen, einrasten". Aus der Vorstellung von ineinander einrastenden Werkstücken beziehungsweise aus dem Auftreffen auf ein Ziel leitet sich die übertragene Bedeutung von klappen als "gut funktionieren" ab.
Sprecher:Fast jeder Schriftsteller braucht viel Geduld, bis es mit dem Erfolg als Buchautor klappt. Der Weg vom Manuskript, dem selbstgeschriebenen Text, abgeleitet vom lateinischen "manu scriptus", mit der Hand geschrieben, bis zum gedruckten Buch ist lang. Vor allem, wenn der Verfasser oder die Verfasserin noch jung und unbekannt ist.
Wolfgang Bittner:"Ich habe mehrere Jahre, Ende der 70er Jahre, an einem Roman gearbeitet, 'Der Aufsteiger, oder ein Versuch, zu leben'. Das wurde damals ein literarischer Bestseller. Das Manuskript habe ich mindestens vier oder fünf Verlagen angeboten, bis es angenommen wurde."
Sprecherin:Das englische Leihwort Bestseller ist, in Bezug auf Bücher, ein fester Bestandteil der deutschen Sprache geworden. Ein Bestseller ist ein Buch, das außerordentlich hohe Verkaufszahlen erzielt. Ein eigenes deutsches Wort mit der selben Bedeutung gibt es nicht. Allerdings wird der Begriff Bestseller nur und ausschließlich für Bücher verwendet. Auf andere Artikel, egal, wie gut sie sich verkaufen mögen, findet er keine Anwendung.
Sprecher:Jeder Schriftsteller träumt davon, mindestens einmal im Lauf seiner Karriere einen Bestseller zu schreiben. Denn ein Buch, das sich sehr oft verkauft, bringt nicht nur Berühmtheit, sondern auch gute Einnahmen. Das Honorar eines Schriftstellers setzt sich zusammen aus einer Summe, die er für seinen Text bekommt, und einer Beteiligung am Verkauf des fertigen Buches. Verkauft sich das Buch gut, verdient der Schriftsteller mehr. Trotzdem muss er fleißig sein und viel und gut schreiben, um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können.
Wolfgang Bittner:"Von einem Buch, selbst wenn man mal ein Buch hat, das gut läuft, kann man nicht so lange leben, wie manche meinen. Man muss immer mal ein Buch haben, das gut geht. Es sind Ausnahmefälle, wo eine Autorin oder ein Autor, wie zum Beispiel Frau Rowling mit 'Harry Potter', Millionärin wird."
Sprecherin:Etwas, das gut läuft, oder gut geht, ist erfolgreich. Der Ausdruck ist in den unterschiedlichsten Zusammenhängen gebräuchlich. So kann zum Beispiel eine Karriere gut laufen, aber auch ein Fußballspiel, eine Prüfung oder eben der Verkauf eines Buches. Die Bücher über den Zauberlehrling Harry Potter, die die britische Schriftstellerin Joanne K. Rowling verfasst hat, laufen in der Tat außerordentlich gut.
Sprecher:Wolfgang Bittner schreibt neben Literatur für Erwachsene auch Bücher für Jugendliche und Kinder. An alle Texte, egal, ob sie von jungen oder älteren Menschen gelesen werden, verwendet er die gleiche Sorgfalt.
Wolfgang Bittner:"Ich finde, dass Bücher, auch so genannte hochwertige Literatur, den Leser nicht unbedingt langweilen muss. Ich persönlich versuche einerseits zu unterhalten, andererseits versuche ich aber auch, einige Gedanken zu transportieren in meinen Romanen, in Gedichten, in Geschichten, die mir wichtig erscheinen."
Sprecherin:Der Roman, abgeleitet vom altfranzösischen "romanz", einer Erzählung in französischer Sprache, ist eine umfangreiche Erzählung, lang genug, um ein ganzes Buch zu füllen. Eine kürzere Erzählung, von deren Sorte mehrere in ein Buch passen würden, ist eine Novelle. Ein Text oder eine Abhandlung, die nur eine, oder wenige Seiten umfasst, ist ein Essay, zu deutsch Aufsatz.
Sprecher:Romane, Novellen oder Essays sind in Prosa abgefasst. Prosa, vom lateinischen "oratio prosa", ungebundene Rede, bezeichnet eine Sprache, die der gesprochenen Sprache entspricht. Das Gegenstück zur Prosa ist das Gedicht. In Gedichten ist die Sprache auf besondere Weise gebunden, in Zeilen, manchmal in Reime gefasst, eben verdichtet. Zur Prosaliteratur gehört auch Wolfgang Bittners Jugendbuch "Die Fährte des grauen Bären". Dieser Roman ist eines seiner erfolgreichsten und meistverkauften Werke. Es schildert das Schicksal einer Gruppe junger Deutscher, die in der kanadischen Wildnis ein Leben fernab der Zivilisation versuchen.
Zitat:Aus "Die Fährte des grauen Bären":
"Am Anleger saßen Manfred, Gordon und Linda, die ein übelriechende Tabakspfeife herumgehen ließen. Stefan setzte sich zu ihnen und schnüffelte. 'Das stinkt ja wie angebrannte Socken! Was raucht ihr denn da?' 'Wir nennen es Kinnik-Kinnik. So heißt bei den Indianern der Tabak. Ist aus getrockneten Blättern mit Majoran und Thymian gemischt.' Gordon grinste. 'Ist auch noch ein bisschen Stoff dabei,' ergänzte er. 'Stoff?' 'Gras,' lachte Gordon. 'Willst'e auch 'nen Zug?' Stefan lehnte dankend ab. 'Ich bin doch nicht in den Busch gekommen, um mir hier so ein Zeug reinzuziehen!"
Sprecherin:Sich etwas reinziehen ist ein umgangssprachlicher Ausdruck dafür, etwas zu sich zu nehmen, etwas zu konsumieren. Der Begriff ist ein typisches Beispiel für Jugendsprache.
Sprecher:Ein Schriftsteller, der für junge Leser schreibt, muss sich natürlich auch in der Sprache der jungen Leute ausdrücken können. Dabei darf er nicht vor Ausdrücken zurückschrecken, die unter Kindern und Jugendlichen gerade modern sind. Auch, wenn er sie in Texten für Erwachsene nicht verwenden würde, weil sie nicht zur Hochsprache gehören. Wolfgang Bittner findet seine Anregungen dabei im eigenen Haus.
Wolfgang Bittner:"Das hing mit meinen eigenen Kindern zusammen. Ich habe drei Kinder, die nun allerdings schon etwas älter sind. Ich musste zum Beispiel meiner Tochter, die inzwischen 26 Jahre alt ist und Psychologie studiert, abends, wenn sie ins Bett ging, immer etwas vorlesen, weil sie nicht einschlafen konnte. Und manchmal hab ich mir dann Notizen gemacht, oder sogar eine Skizze aufgeschrieben. Ich habe eine ganze Schublade voll solcher Skizzen. Und ab und zu greif' ich hinein, und dann entsteht, wenn ich Glück habe, ein neues Bilderbuch."
Sprecherin:Ein Bilderbuch ist ein Buch für ganz kleine Kinder. Ein Buch, das hauptsächlich aus Bildern besteht, und in dem nur ganz wenig, manchmal gar kein Text vorkommt.
Wolfgang Bittner:"Ich habe gerade ein neues Buch veröffentlicht, 'Beruf Schriftsteller'. Nach zwei, drei Monaten waren etwa 30 Besprechungen da, überwiegend sehr positiv, aber eben auch zwei Verrisse, die mir dann doch zu schaffen machten, weil ich feststellte, das ist unfair, was da mit diesem Buch geschieht und mit dem Autor."
Sprecherin:Der Verriss ist bei allen Künstlern gefürchtet. Ein Verriss, vom mittelhochdeutschen "verrizen", zerreißen, ist eine vernichtend schlechte Kritik. Solche Kritiken stehen für gewöhnlich in der Zeitung, und jedermann kann sie lesen. Sie können Bücher und ihre Verfasser treffen, aber auch Schauspieler, Sänger und andere Künstler.
Sprecher:Außer den Kritikern können auch die Verlage den Schriftstellern das Leben schwer machen. Verlage sind die Institutionen, die einen Text drucken und als Buch auf den Markt bringen. Man sagt dazu auch, ein Buch verlegen. Der Begriff Verlag für eine Firma, die Druckwerke herausgibt, hat sich im 17. Jahrhundert entwickelt. Er leitet sich vom Begriff "auslegen" ab, also, Geld für jemanden oder etwas, in diesem Fall eben Drucke, zur Verfügung stellen. Da Verlage an den Büchern ihrer Schriftsteller verdienen, mischen sie sich manchmal stark in die künstlerische Arbeit ein.
Wolfgang Bittner:"Ich bin immer ganz froh, wenn ich dem deutschen Literaturbetrieb für einige Wochen und Monate den Rücken kehren kann. Das geht doch recht neurotisch und oft auch intrigant zu. Sie machen einem Vorgaben und bevormunden einen sehr stark.
Sprecherin:Manchmal werden Schriftsteller von den Verlagen bevormundet. Das Verb bevormunden, ebenso wie das dazugehörige Substantiv Vormund, geht zurück auf das althochdeutsche "foramunto", was so viel bedeutet wie "Rechtsbeistand", "Rechtsvertreter". Ein Vormund kann für eine andere Person Entscheidungen treffen. Bevormunden bedeutet also, jemanden in seiner Entscheidungsfreiheit einzuschränken, jemandem Ideen oder Entscheidungen aufzuzwingen.
Sprecher:Der Schriftsteller Wolfgang Bittner pflegt sich in die kanadische Wildnis zurückzuziehen, wenn ihn der heimische Literaturbetrieb zu bevormunden beginnt. In der urwüchsigen Landschaft schöpft er Kraft. Außerdem war sie ihm bereits Inspiration für vier Romane. Einer davon ist "Die Fährte des grauen Bären". An einer Stelle versucht der junge Deutsche Stefan, Kanufahren zu lernen.
Zitat:Aus "Die Fährte des grauen Bären":
"Sie zogen noch eine Runde über die Bucht und kamen wieder zum Anleger zurück. Gordon sprang hinaus und hielt das Boot fest, damit Stefan ebenfalls aussteigen konnte. Stefan merkte, wie die anderen gespannt zuschauten. 'Guckt ihr nur. Ganz so ungeschickt, wie ihr glaubt, bin ich nun auch wieder nicht.' Aber gerade in dem Moment, in dem er einen Fuß noch im Boot, und einen auf dem Anleger hatte, ließ Gordon los. So unerwartet, dass Stefan sofort sein Gleichgewicht verlor. Verzweifelt versuchte er, sich vom Kanu abzustoßen, doch es glitt unter ihm weg. Und ehe er sich's versah, schlug das Wasser über seinem Kopf zusammen."
Sprecherin:Stefan taucht unversehrt wieder auf. Nur das Gelächter der anderen muss er ertragen. "Die Fährte des grauen Bären" ist ein Buch, das Wolfgang Bittner oft mitnimmt, wenn er Lesungen in Schulen hält. Lesungen, also öffentliche Vorträge aus eigenen Werken, sind ein wichtiger Bestandteil im Alltag eines Schriftstellers. Sie ermöglichen ihm den direkten Kontakt zu seinem Publikum und tragen dazu bei, ihn und seine Werke bekannt zu machen.
Sprecher:Auch wenn Wolfgang Bittner noch nicht verrät, welches Thema sein nächstes Buch behandeln wird – etwas wird auf jeden Fall im Mittelpunkt stehen, ganz, wie es sich für einen guten Schriftsteller gehört: die Kunst, Buchstaben in lebendige Geschichten zu verwandeln und damit Leser zu fesseln, die Kunst der Worte.
Fragen zum Text
Wer oder was ist ein Verfasser?
1. jemand, der einen Text, gleich welcher Art, geschrieben hat
2. jemand, der in schlechter Verfassung ist
3. jemand, der alles anfassen muss
Was ist ein Bestseller?
1. ein Buch, das sich schlecht verkauft
2. ein Buch, das sich sehr gut verkauft
3. ein Spielzeug, das sich sehr gut verkauft
Was bedeutet das Verb bevormunden?
1. jemandem alle Freiheiten lassen
2. jemandem Entscheidungen aufzuzwingen
3. jemanden küssen
Arbeitsauftrag
Stellen Sie Ihrer Klasse Ihr Lieblingsbuch vor. Erklären Sie worum es geht, welche Personen darin vorkommen und was Ihnen daran so gut gefällt. Lesen Sie außerdem einen interessanten Abschnitt daraus vor.
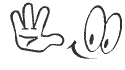 Download Material im MP3Bitte beachten Sie folgendes: Wenn Sie Windows als Betriebssystem nutzen, können Sie MP3 Dateien direkt per Mausklick anhören. Wollen Sie die Datei auf Ihrer Festplatte speichern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Icon und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl "Ziel speichern unter". Jetzt können Sie einen beliebigen Platz auf Ihrer Festplatte auswählen, um die Audiodatei abzulegen.
Download Material im MP3Bitte beachten Sie folgendes: Wenn Sie Windows als Betriebssystem nutzen, können Sie MP3 Dateien direkt per Mausklick anhören. Wollen Sie die Datei auf Ihrer Festplatte speichern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Icon und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl "Ziel speichern unter". Jetzt können Sie einen beliebigen Platz auf Ihrer Festplatte auswählen, um die Audiodatei abzulegen.Labels: Alltag Deutsch, Gramatik, HV, Stichwort