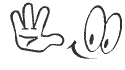Samstag, 16. Juni 2007

Hinter Klostermauern steht die Zeit nicht still. Die Nonnen im Franziskanerinnen-Kloster sind alles andere als weltfremd. Im Gegenteil, sie sind starke Frauen, die Aufgaben haben und aktiv ihren Glauben leben.
Vesper:
Oh Gott, komm uns zu Hilfe.....Halleluja!
Sprecherin:
Ora et labora, bete und arbeite! Die uralte Grundregel für ein religiöses Leben. Auch der Alltag im Franziskanerinnen-Kloster Waldbreitbach im Westerwald besteht aus Gebet und Arbeit. Neben seinen religiösen Pflichten widmet sich der Orden intensiv der Kranken- Alten- und Kinderbetreuung. Leben im Dienst der Schwachen - ganz nach dem Vorbild des Namensgebers, des Heiligen Franziskus von Assisi.
Sprecher:
Ein Kloster ist eine abgeschlossene Wohnstätte von Mönchen oder Nonnen. Der Begriff leitet sich ab vom lateinischen 'claustrum': Riegel, Schloss, Sperre. Ein Orden ist eine nach bestimmten Regeln lebende Gemeinschaft. Das Wort geht zurück auf das lateinische 'ordo': Stand, Ordnung, Regel. Gleicher Herkunft ist die Bezeichnung Orden für eine Auszeichnung, ein ziviles oder militärisches Ehrenzeichen.
Sprecherin:
Der Franziskanerinnen-Orden von Waldbreitbach wurde 1863 von einer jungen Westerwälderin namens Margarethe Flesch gegründet. Die tiefreligiöse Frau kümmerte sich in ihrer Heimat, der Region zwischen Bonn und Koblenz, um Kinder ohne Eltern, Alte und Kranke. Bald schlossen sich ihr weitere Frauen an. Sie beschlossen, nicht nur Gutes zu tun, sondern auch nach den Regeln einer klösterlichen Gemeinschaft zu leben. Schwester Emanuela Henneken gehört heutzutage zu dieser Gemeinschaft.
Schwester Emanuela Henneken:
"Die Margarethe Flesch war Fanziskaner-Terziarin. Gehörte also diesen weltlichen Orden des Heiligen Franziskus an. Und als sie dann die Genehmigung 1863 bekam, eine geistliche Gemeinschaft zu gründen, da war das für sie klar, dass das eine franziskanische Gemeinschaft werden würde."
Sprecherin:
Der Begriff Franziskaner geht zurück auf den italienischen Ordensgründer Franz von Assisi. Die Bruderschaft, die er selber um das Jahr 1200 herum ins Leben gerufen hat, wird heute als 'Erster Orden' bezeichnet. Den dazugehörigen Frauenorden, die Klarissen, gründete die Zeitgenossin und Vertraute des Franziskus, Klara von Assisi. Diese Gemeinschaft trägt die Bezeichnung 'Zweiter Orden'.
Sprecher:
Der 'Dritte Orden', die Franziskaner-Tertiaren, abgeleitet vom lateinischen tertius: der Dritte, bezeichnete ursprünglich Gemeinschaften, die außerhalb der Klöster, im alltäglichen Leben, nach franziskanischen Regeln lebten. Besonders in der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelten sich aus diesen nicht-klösterlichen - man sagt auch weltlichen - Gemeinschaften wieder franziskanische Orden. Zum Beispiel der der Franziskanerinnen von Waldbreitbach. Immer gleich geblieben sind die Ordensregeln, die Lebensregeln des Heiligen Franziskus:
Schwester Emanuela Henneken:
"Das Ideal der Armut ist ein ganz Großes, und der Solidarität mit Menschen, die am Rande stehen. Und dann noch etwas, von Franziskus her gesehen: Dass er alle Geschöpfe, alle Kreatur, die ganze Schöpfung, als Bruder und als Schwester sieht. "
Sprecherin:
Das Wort Schöpfung leitet sich vom althochdeutschen 'skepfen': etwas in Form bringen, erschaffen, ab. Im religiösen Sinne ist damit die Schöpfung Gottes gemeint, die Erschaffung alles Existierenden durch Gott. Ein Geschöpf, abgeleitet vom gleichen Wortstamm, ist folglich etwas Erschaffenes. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Begriff Geschöpf jedoch nur verwendet, wenn damit Tiere oder Menschen gemeint sind. Gegenstände bezeichnet er nicht.
Sprecher:
Das Ideal der Armut verwirklichen die Franziskanerinnen von Waldbreitbach dadurch, dass alle Gelder, die sie erwirtschaften, der klösterlichen Gemeinschaft zufließen. Alle Anschaffungen werden aus diesem gemeinsamen Vermögen bestritten. Den respektvollen Umgang mit der Schöpfung praktizieren sie zum Beispiel durch ihren Dienst an Kranken. So gehört zum Franziskanerinnen-Kloster in Waldbreitbach eine große, anerkannte Fachklinik für Psychiatrie. Auch in der Betreuung von alten und sterbenden Menschen sieht Schwester Basina Kloos, die Leiterin der Franziskanerinnen von Waldbreitbach, die Möglichkeit, die Regeln des Heiligen Franziskus umzusetzen:
Schwester Basina Kloos:
"Wir waren eine der ersten Gemeinschaften, die dann ein Hospiz aufgebaut hat, das weitergeführt hat, aber auch versucht, herauszufinden, was würde sowohl unsere Stifterin, als auch der Heilige Franziskus heute tun? Er hat sich ja um Aussätzige gekümmert. Wo sind Aussätzige unserer Zeit? Das würde für uns heute zum Beispiel Einsamkeit bedeuten. So haben wir durchaus einen Auftrag darin gesehen, für ältere Menschen in Heimen und auch sonst, in Begegnungsstätten, eine Möglichkeit der Begegnung zu stiften, damit diese Einsamkeit abgebaut wird."
Sprecherin:
Stiften, abgeleitet vom althochdeutschen ‚istiftan‘: auf Holzpfählen ein Gebäude errichten, bedeutet etwas zu gründen. Man sagt auch: etwas ins Leben zu rufen. Meistens trägt das Verb stiften und das dazugehörige Substantiv Stiftung eine finanzielle Komponente in sich. Ein Stifter oder eine Stifterin bezahlt die jeweilige Gründung, die Stiftung, mit eigenem Geld. Anders ausgedrückt: aus eigener Tasche. Aussatz, vom mittelhochdeutschen ‚ußsetzic‘: abgesondert, ist ein nicht mehr ganz modernes Synonym für die ansteckende Krankheit Lepra. Schwester Basina überträgt den Begriff Aussatz auf Eigenschaften, die heutzutage die Absonderung von der Gesellschaft bedeuten. Zum Beispiel Alter oder Armut.
Sprecher:
Das Wort Hospiz leitet sich vom lateinischen Adjektiv ‚hospitalis‘: gastfreundlich, ab. Ähnlich wie das verwandte Wort Hospital bezeichnet Hospiz ein Haus für Kranke. Im Gegensatz zum Hospital, auch Krankenhaus genannt, sind Hospize nur für unheilbar kranke Menschen, die bald sterben werden, vorgesehen. Hospize sind dazu da, sterbende Menschen mit liebevoller Zuwendung, aber natürlich auch mit aller ärztlichen Kunst, auf ihrem letzten Weg zu begleiten. Innerhalb der pflegerischen Tätigkeiten eine der die schwierigsten und härtesten Aufgaben. Auch Schwester Edith Maria Schug wurde bei den Waldbreitbacher Franziskanerinnen zunächst für Pflegedienste ausgebildet:
Schwester Edith Maria Schug:
"Ich hab in der Ordensgemeinschaft dann die Krankenpflege gelernt und habe jetzt auch als Krankenschwester gearbeitet die ganze Zeit und war letztes Jahr in Benediktbeuren zum Studium und bin jetzt hier auf dem Berg und hab ein Haus mit 50 Übernachtungsmöglichkeiten vorwiegend für junge Menschen, die kommen hierher und machen zum einen Orientierungstage oder Besinnungstage. Und wir beschäftigen uns mit Themen des Lebens. Das ist: Drogen, Alkohol; das ist: Gewalt, das ist: Familie, das ist: Zukunft, das ist auch: Gott - gibt's einen Gott, gibt's keinen Gott - so die Themen, die von den Jugendlichen gewollt sind. Und gleichzeitig essen wir auch zusammen, haben auch gemeinsam Freizeit und lernen uns kennen. Und miteinander kommt man dann auch ins Gespräch."
Sprecher:
Schwester Edith Maria ist mit 36 Jahren die Jüngste im Franziskanerinnenkloster von Waldbreitbach. Auf den ersten Blick ist der hübschen jungen Frau nicht anzusehen, dass sie einem Orden angehört. Genau wie ihre Mitschwester Emanuela trägt sie einfache Straßenkleidung. Nur ein silbernes Kreuz und eine kleine Plakette mit einer Darstellung der Jungfrau Maria, die die Schwestern an einer Kette um den Hals tragen, zeigt ihre Ordens-Zugehörigkeit. Bei aller Weltoffenheit und Modernität ist das klösterliche Leben der Franziskanerinnen in erster Linie trotzdem von Jahrhunderte alten, feststehenden religiösen Bräuchen bestimmt. Die gemeinsamen Gebete und Gottesdienste bilden das Gerüst des Tagesablaufs. Frühes Aufstehen ist dabei Pflicht.
Schwester Edith Maria Schug:
"Wir beten gemeinsam die Laudes und dann gehen wir in die Heilige Messe, die ist meistens morgens um sieben. Dann frühstücken wir zusammen, und dann gehe ich in das Jugendhaus, und wir treffen uns dann abends noch mal zum Abendgebet und zum Abendessen. Wenn ich eine Gruppe habe, ist auch abends da immer was los."
Sprecherin:
Der Name Laudes für das klösterliche Morgengebet stammt vom lateinischen Wort für loben, lobpreisen: ‚laudare‘. Die lateinische Bezeichnung für das Abendgebet ist Vesper. Sie leitet sich ab von ‚vespera‘, dem Wort für Abendzeit.
Vesper:
Der Herr ist mein Hirte, er führt mich zum Wasser des Lebens....
Sprecher:
Vor allem die Gottesdienste und gemeinsamen Gebete haben Schwester Edith Maria im Alter von 21 Jahren so sehr begeistert, dass sie ihren Beruf als Schneiderin aufgab und sich den Franziskanerinnen von Waldbreitbach anschloss.
Schwester Edith Maria Schug:
"Was mich fasziniert hat: dass Frauen, dass Menschen miteinander beten und miteinander über Gott reden, dass das im Alltag einfach dazugehört, dass es dafür sogar feste Zeiten gibt. Und dann hab ich mir verschiedene Ordensgemeinschaften angeschaut und mitgelebt. Und bin dann irgendwie nach Waldbreitbach gekommen, um zu eher suchen, ist das mein Weg, ist das eine Lebensform, die auch ich leben kann, weil, ich hielt mich jetzt nicht unbedingt für fromm genug. Aber im Hineinwachsen hab ich gemerkt, das ist genau das, was ich gesucht habe."
Sprecherin:
Fromm ist ein anderer Ausdruck für gläubig oder religiös. Er geht auf das mittelhochdeutsche 'vrum', das Wort für rechtschaffen, zurück. Erst seit dem 15. Jahrhundert hat das Adjektiv fromm seinen spezifisch religiösen Inhalt.
Sprecher:
Heutzutage entscheiden sich nur noch wenige Frauen, ihre Frömmigkeit in einem Kloster auszuleben. In Waldbreitbach sind es nur noch 91 Franziskanerinnen. Die meisten von ihnen sind über 60 Jahre alt. Die fast 500 Arbeitsplätze, die das Kloster durch seine Klinik, seine Bildungseinrichtungen, sein Restaurant, seine Gärtnerei und andere, der Öffentlichkeit zur Verfügung stehende Einrichtungen zu vergeben hat, sind daher fast ausschließlich von weltlichen Fachkräften besetzt. Schwester Edith Maria, die das klostereigene Jugend-Gästehaus leitet, hat das lange Aufnahmeverfahren für den Orden durchlaufen. Sie kann ihm daher für immer angehören.
Schwester Edith Maria Schug:
"Wenn sich eine Frau entscheidet, zu uns in die Gemeinschaft zu kommen, dann wird sie erstmal Kandidatin. Man soll der Gemeinschaft dann näher kommen, also näher wohnen, wo Schwestern von uns sind. Und dann wird man aufgenommen als Postulantin. Das ist die Zeit, in der man schon zur Gemeinschaft gehört, aber noch keine Schwester ist. Da muss man sich auch trennen vom Arbeitgeber, von der Familie, und wohnt innerhalb der Gemeinschaft. Dann wird man Novizin, man kriegt den Schwestern-Namen, hat aber noch keine festen Gelübde abgelegt. Das geht ungefähr zwei Jahre. Dann kann man zum ersten Mal versprechen, für drei Jahre in Armut, Gehorsam und eheloser Keuschheit zu leben. Und dann kann man noch mal auf zwei Jahre die Gelübde ablegen und dann kann man auf Ewig. Aber das ist die ganze Zeit immer so das Prüfen der Gemeinschaft für die Einzelne und die Einzelne für die Gemeinschaft, passt das."
Sprecherin:
Die Kandidatin, vom lateinischen 'candidatus': Amtsbewerber, wird zur Postulantin, vom lateinischen ‚postulatio‘: Forderung. Ist ihrer Forderung nach Aufnahme stattgegeben worden, ist sie Novizin, ein Neuling, abgeleitet vom lateinischen Adjektiv 'novus': neu. Neue Ordensfrauen können sich einen Schwestern-Namen wählen. Das heißt, sie können ihrem Vornamen einen Namen mit religiöser Bedeutung hinzufügen oder ihn ersetzen. So wurde zum Beispiel aus Wilhelmina Henneken Schwester Emanuela. Der Name kommt aus dem Hebräischen und bedeutet 'Gott mit uns'. Die Namensänderung ist heutzutage allerdings keine Pflicht mehr.
Sprecher:
Verpflichtend dagegen sind die Gelübde, die feierlichen Versprechen, zum Orden zu gehören und nach seinen Regeln zu leben. Der Begriff geht zurück auf das althochdeutsche Wort 'gilubida': Übereinstimmung. Ordensfrauen, die alle Gelübde abgelegt haben, tragen als sichtbares Zeichen lebenslanger Verbundenheit mit ihrer Gemeinschaft einen Ehering. Ebenfalls aus dem Althochdeutschen, und zwar von 'kuski', dem Ausdruck für enthaltsam, züchtig, kommt der Begriff Keuschheit. Gemeint ist der Verzicht auf körperliche Liebe. Keuschheit gilt als Grundvoraussetzung für ein Leben als Priester oder Ordensfrau. Für die Ehelosigkeit von Geistlichen steht das lateinische Leihwort Zölibat. Es bedeutet soviel wie unverheiratet.
Sprecherin:
Schwester Edith Maria und ihre Mitschwestern vom Franziskanerinnenkloster Waldbreitbach haben sich freiwillig den Regeln ihres Ordens unterworfen. Trotzdem müssen auch sie sich immer wieder mit Zweifeln und Konflikten auseinandersetzen. Romantische Vorstellungen haben hier wenig Platz.
Sprecher:
So bedeutet das Klosterleben für Schwester Edith Maria und ihre Mitschwestern vom Franziskanerinnenkloster in Waldbreitbach keineswegs eine Flucht vor der Welt. Sie sind starke Frauen, die Aufgaben und Ziele haben und aktiv ihren Glauben leben. Eben: beten und arbeiten. Ora et labora.
Fragen zum Text
Was ist ein Kloster?
a. Eine Wohnstätte für Mönche und Nonnen.
b. Eine Schule.
c. Ein Geschäft.
Welche Menschen leben in einem Hospiz?
a. In einem Hospiz leben gesunde Menschen.
b. In einem Hospiz leben unheilbar kranke Menschen.
c. In einem Hospiz leben kranke Menschen, die wieder gesund werden.
Wie wird das Abendgebet genannt?
a. Orden
b. Laudes
c. Vesper
Arbeitsauftrag
Arbeiten und beten - der Tagesablauf in einem Kloster ist streng geregelt. Wie sieht ihr Tag normalerweise aus? Beschreiben Sie in einem kurzen Aufsatz, wie ein typischer Tag in Ihrem Leben aussieht. Wann stehen Sie auf? Was frühstücken Sie? Wie verbringen Sie den Rest des Tages? >>Catrin Möderle<<
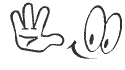 Download Material im MP3Bitte beachten Sie folgendes: Wenn Sie Windows als Betriebssystem nutzen, können Sie MP3 Dateien direkt per Mausklick anhören. Wollen Sie die Datei auf Ihrer Festplatte speichern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Icon und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl "Ziel speichern unter". Jetzt können Sie einen beliebigen Platz auf Ihrer Festplatte auswählen, um die Audiodatei abzulegen.
Download Material im MP3Bitte beachten Sie folgendes: Wenn Sie Windows als Betriebssystem nutzen, können Sie MP3 Dateien direkt per Mausklick anhören. Wollen Sie die Datei auf Ihrer Festplatte speichern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Icon und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl "Ziel speichern unter". Jetzt können Sie einen beliebigen Platz auf Ihrer Festplatte auswählen, um die Audiodatei abzulegen.Labels: Alltag Deutsch, Gramatik, Sprachbar